
Interview mit Benjamin Eberling: „Zu dick für Disney“
Musicaldarsteller Benjamin Eberling hat schon viele Rollen gespielt und sich in der Branche einen Namen gemacht. Im Interview berichtet er von seinen Erfahrungen mit Rollenbesetzungen, die stark von äußeren Erscheinungen beeinflusst sind, reflektiert über Veränderungen in der Branche und erzählt von seiner persönlichen Reise, sich trotz Schubladendenken und Vorurteilen treu zu bleiben.
Auf deinem T-Shirt steht „Bear“. Das passt gut zur ersten Frage: Was ist eigentlich aus dem „Jumping Musical Bear“ geworden? Früher hast du doch auf deinem Instagram-Kanal immer Fotos veröffentlicht, die dich an verschiedenen Orten auf der Welt im Spagatsprung zeigten. Du warst der springende Musicalbär.
Ja, der „Jumping Musical Bear“ hat sich verletzt auf der Bühne. Vor mittlerweile drei Jahren war das im Schmidt Theater. Da habe ich mir mein Knie verdreht und einen Knorpelschaden gehabt, der operiert werden musste. Nach der OP wurde mir gesagt, dass die Spagatsprünge leider nicht mehr drin sind. Die sollte ich unterlassen. Deswegen ist es jetzt leider nicht mehr mein Markenzeichen. Ich weine dem sehr nach. Jedes Mal, wenn ich einen schönen Spot sehe und denke, jetzt würde ich gern, kommt dann doch die Vernunft.
Ich erinnere mich, dass ich in Hamburg eines morgens im Hotel war und dort im Frühstücksraum die Bild-Zeitung auslag, die über den „Jumping Musical Bear“ berichtet hat.
Ja, das war damals bei „The Voice“, wo ich in der Blind Audition war. Die Hamburger „Bild“ hat einen Bericht über mich gebracht, für den wir vor dem Rathaus ein geiles Bild gemacht haben.
Mit dem „Jumping Musical Bear“ bist du auf Instagram so richtig durchgestartet, nicht wahr?
Ja, 2015 ging das so richtig los. Es ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ich mache das gern, aber habe mich da auch ein bisschen zurückgenommen, als die Corona-Pandemie anfing. Ich habe damals mit dem „Schlager des Tages“ versucht, positiven Content zu verbreiten, bin dann aber irgendwann auch in so ein Loch gefallen und habe mich gefragt, wie es weitergehen soll. Als ich mit Instagram angefangen habe, meinte mein Freund und Kollege Gino Emnes, dass ich was finden sollte, was mich ausmacht und mir Spaß macht – wie die Spagatsprünge. Die habe ich damals immer auf dem Kreuzfahrtschiff gemacht, aber sie waren noch nicht perfekt. Das habe ich dann über die Jahre perfektioniert.

Mit Tanz und Bewegung hast du also generell kein Problem?
Nein, alle sind immer begeistert, wie beweglich ich bin. Francesc Abós war letztes Jahr bei „Mozart!“ schon begeistert, wie beweglich ich bin. Danach habe ich „Flashdance“ und „Titanic“ gemacht. Kerstin Ried, die bei „Titanic“ die Choreografie gemacht hat, sagte immer zu mir: Ben, du tanzt viel zu gut für deine Rolle, das geht gar nicht. Bei „Robin Hood“ wurde mir auch gesagt, dass ich zu leichtfüßig bin und der Tuck viel schwerfälliger sein muss. Demnächst werde ich noch zur Tanz-Audition eingeladen und nicht mehr zu den Movern. (lacht) Aber ich bewege mich eben unglaublich gern. Das erwarten viele Leute halt nicht von so einem Teddybären. Die Spagatsprünge sind zwar raus, aber die Beweglichkeit ist immer noch da.
Du stehst wiederholt bei den Freilichtspielen Tecklenburg auf der Bühne. Was macht diese Bühne für dich aus?
Gerade dieses Jahr war es nicht einfach mit dem Wetter – mal sehr heiß, dann wieder regnerisch. In der Probenphase bei „Mamma Mia!“ hatten wir in der ersten Woche um die 30 Grad. Da dachten wir, das wird der perfekte griechische Sommer. Aber dann wurde es kalt, und wir hatten Runs bei neun Grad. Aber egal, denn hier herrscht so ein besonderes Flair. Ich mag die Bühne unglaublich gern, auch wenn sie sehr tricky ist mit den ganzen unebenen Stufen, Steinboden und so weiter. Ich mag einfach die Atmosphäre hinter der Bühne im Apfelgarten. Ich mag dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was man im Theater ja eigentlich immer hat. Aber gerade im Stadttheater, wo man dann halt nur ein- bis zweimal im Monat spielt, wächst es nicht so zusammen. Oder in einer Großproduktion, wo man achtmal pro Woche spielt, geht man sich manchmal irgendwann gegenseitig auf den Keks. In Tecklenburg ist es zeitlich befristet. In diesen Monaten haben alle richtig Bock. Dazu kommen die Inszenierungen, die immer frisch sind. So wie jetzt „Mamma Mia!“, eine Inszenierung, die noch nicht seit zehn Jahren durchgenudelt wird. Was ich auch so unglaublich liebe, ist das Orchester. Welche Großproduktion leistet sich denn noch so ein großes Orchester wie in Tecklenburg? Keine. Das ist einfach toll. Deswegen ist es immer schön, wenn man die Anfrage bekommt, ob man zurückkommen möchte, was auch nicht selbstverständlich ist, weil Tecklenburg ein sehr wichtiger und beliebter Arbeitsplatz ist. Es ist eine Bühne, auf der alle einmal spielen wollen und die hart umkämpft ist. Ich bin sehr dankbar, dass mir hier der Intendant und die Regisseure so eine Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringen, was für mich nicht selbstverständlich ist. Vor allem habe ich ja nicht so einen bekannten Namen. Klar, ich habe einen gewissen Namen, aber bin eben keiner von den ganz Großen der Branche.
Du spielst in diesem Jahr sowohl in „Mamma Mia!“ als auch in „3 Musketiere“. Erstere Show ist immer ausverkauft, das zeichnete sich schon vor der Premiere ab. Wie ist das für dich?
Ich habe schon immer die Einstellung gehabt, dass es für mich keinen Unterschied macht, ob ich für 200 oder 2.000 Menschen spiele. „Kinky Boots“ war für mich eine sehr emotionale Geschichte, eine unglaublich tolle Produktion, aber wir haben dort teilweise wirklich nur vor 200 Leuten gespielt. Allerdings haben auch die ihr Geld bezahlt, genauso wie die 2.320 Leute, die in jeder Vorstellung von „Mamma Mia!“ sitzen. Das ist mir also egal. Es ist mein Job, die Leute haben bezahlt und haben im besten Fall einen wundervollen Abend. Natürlich ist es schön, wenn über 2.000 Menschen für dich applaudieren. Aber es ist genauso schön, wenn 200 applaudieren. Manchmal können wenige Leute sogar mehr Stimmung machen als viele. Es kommt immer auf das Publikum an. Hin und wieder hat man auch mal ein etwas dezenteres Publikum. Man bekommt als Darsteller sofort mit, ob ein Witz ankommt oder nicht. Das macht den besonderen Zauber von Live-Theater aus.

Wenn man sich deine bisherigen Rollen anschaut, sind das fast alles eher – nennen wir sie mal so – kernige Typen, die du gespielt hast. Ist das tatsächlich dein Rollenprofil? Fühlst du dich in diesen Rollen wohl oder ist das vielleicht auch ein bisschen Fluch und Segen zugleich?
Ja, es ist halt der Fluch der Charakterrolle. Das habe ich von Anfang an – schon in der Ausbildung – immer mitbekommen. Ich bin halt nicht das gängige Schema F des Musicaldarstellers. Ich bin ein großer, kräftiger Mann. Das musste ich mit der Zeit erst mal lernen, vor allem, wenn man in den Anfangszwanzigern und -dreißigern ist, wo alle Kollegen die jugendlichen Liebhaber spielen und man selbst die lustige Nebenrolle oder den tragischen Handlanger des Bösewichts spielt. Das macht etwas mit einem. Aber gerade diese Rollen haben auch ihren Reiz, sie sind toll, die sind auch ganz wichtig. Was ich sehr schade finde, weil ich vom Gesang komme, ist, dass diese Rollen meistens keinen Song haben – und wenn sie einen Song haben, ist das ein Pillepalle-Song. Das muss man leider so sagen. Es ist oft nichts, womit man die Stimme gut zeigen kann. Wobei ich sagen muss, dass sie das bei „Robin Hood“ mit Bruder Tuck wirklich großartig hinbekommen haben. In seinem Song kann man wirklich die komplette Bandbreite der Stimme auspacken. Das ist super, aber sehr selten.
Es liegt aber auch am Kreativteam und den Casting-Verantwortlichen, endlich mal die Rollenprofile aufzubrechen, oder?
Absolut. Ich bin sehr dankbar, dass es mittlerweile Regisseurinnen und Regisseure gibt, die dieses Denken aufbrechen und sagen, ja, mein Held muss jetzt nicht gerade 1,90 Meter und schlank sein, sondern der darf auch mal kräftiger sein. Deswegen fand ich es großartig, bei „The Boys from Syracuse“ in Erfurt mal den romantischen Helden zu spielen und zu sehen, wie langweilig das eigentlich ist. (lacht) Es ist ja immer dieselbe Geschichte: Junge trifft Mädchen, sie verlieben sich, dann gibt’s Streit, Junge verliert Mädchen, am Schluss kriegen sie sich. Das Feuer und den Pfeffer bringen meistens die Bösen und Charakterrollen in ein Stück. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Chance bekomme, ein bisschen mehr den Bösewicht zu spielen. Das konnte ich bei „Kinky Boots“ mit Don schon ein bisschen zeigen, auch mit Curtis in „Sister Act“, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber wenn man erst mal in einer Schublade ist, ist es schwer, dort wieder rauszukommen. Du wirst eben immer gesehen als der Lustige, der sich ein bisschen bewegen kann. Aber ich bin jetzt 44 Jahre alt, da ist noch viel möglich. Also schauen wir mal, wohin die Reise noch geht.
Aktuell hat man auch das Gefühl, zumindest im Musicalbereich, dass sich viel bewegt.
Ja, momentan habe ich auch das Gefühl, dass es in eine sehr gute Richtung geht, weil es einfach viel diverser und vielfältiger wird. Die Leute brechen Rollenprofile auf und sagen, das Alter spielt keine Rolle, das Aussehen spielt keine Rolle. Und man muss mal gucken, wo das hingeht, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich bin da sehr hoffnungsvoll gestimmt.

Womit wir beim Thema Äußerlichkeiten sind. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Wenn ich zurückblicke, war ich schon als kleiner Junge immer ein bisschen kräftiger, aber ich war nicht dick. Trotzdem wurde in den Achtzigern und Neunzigern gesagt, iss doch mal ein bisschen weniger, achte mal auf deine Figur. Auch zu Hause manchmal. Das war immer ein Druck, dass man schlank sein sollte. Gerade auch bei uns im Knabenchor waren viele Jungs einfach schmal und ich dagegen eher propper. Als ich ins Musical ging und mit der Ausbildung begann, habe ich das schon zu spüren bekommen. Ich musste immer mehr arbeiten als der attraktive Ein-Meter-Neunzig-Mann, der durchtrainiert war und ein Sixpack hatte. Deshalb war ich der Erste in der Klasse, der im Spagat saß oder immer die Choreos gemacht hat.
Hast du Rollen aufgrund deiner Körperlichkeit nicht bekommen?
Ja, bei „Aladdin“ hat mich das unfassbar traurig gemacht. Ich wollte immer gerne mal den Dschinni spielen, habe es auch mehrfach versucht. Irgendwann wurde dann vom Creative Team die Entscheidung getroffen, dass man keine dicken Dschinnis wollte, weil man damit entsprechende Erfahrungen gemacht hatte. Da habe ich gesagt, ihr könnt gerne eure Erfahrungen machen, aber ich bin nicht wie jemand anderes, den ihr vielleicht in England oder in Amerika hattet. Ihr habt mich in anderen Produktionen gesehen, ich bin da, ich bin nicht krank. Oder beim „König der Löwen“, wo mir im Casting Scar und Pumbaa gegeben wurde, und als ich im Raum stand, der Associate mich fragte, was ich vorbeireitet habe. Als ich Scar und Pumbaa sagte, guckte er an mir herunter auf meinen Bauch und sagte: Mach‘ mal Pumbaa. Peng, zwölf Seiten Text und Song umsonst gelernt. Oder bei der „Eiskönigin“, wo der Associate mir noch in der Audition sagte, so jemanden wie dich haben wir sechs Jahre gesucht für Oaken. Die Absage lautete: Du bist nicht der Typ für Kristoff oder Hans. Anstatt die Cover anders zu vergeben, wurde ich wegen meiner Figur aussortiert. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Deshalb habe ich auch mein Soloprogramm „Zu dick für Disney“ auf Kreuzfahrtschiffen gemacht, weil ich da alle Disney-Songs singen konnte, die ich schon immer singen wollte – auch die weiblichen, weil die Frauen so tolle Nummern haben. Ich mag Disney einfach sehr gern und irgendwann wird es noch klappen.
Auch wenn sich etwas verändert: Ist das Musicalbusiness noch sehr äußerlich?
Ja, unser Business ist sehr äußerlich, und man merkt es auch – bei den Gesprächen an der Stage Door oder auch bei Instagram, bei Followern, in Social Media. Bei „The Voice“ habe ich es ganz extrem gemerkt. Das kann man sich gerne mal bei Youtube angucken, meine Blind Audition mit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Damals hatte ich noch 50 Kilo mehr, war wirklich sehr kräftig. Da gab es viel Positives, aber auch Kommentare wie „Der sollte mal sein Herz kontrollieren lassen“ oder „Was sucht der Dicke da?“ oder „Der sollte besser über Schinken singen“ oder was weiß ich. Wenn man sich heutzutage der Öffentlichkeit aussetzt, muss man damit rechnen, dass man entweder einen Shitstorm bekommt oder nach Äußerlichkeiten bewertet wird. Menschen sind leider immer noch sehr oberflächlich und werden mittlerweile sehr aggressiv, anstatt sich zu überlegen, dass man andere Menschen damit verletzt.
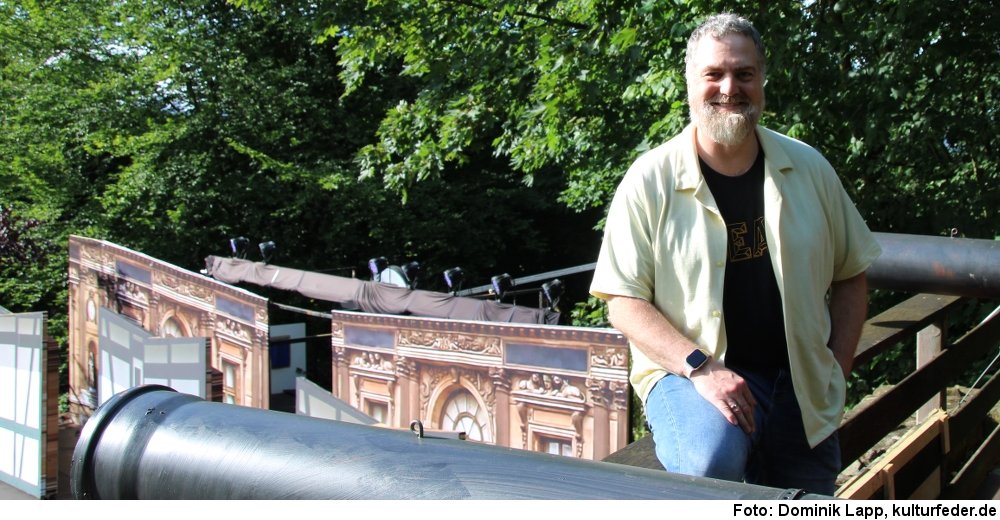
Was wünschst du dir in diesem Hinblick?
Wenn ich auf der Bühne stehe, geht es nicht darum, dass sich Leute in mich verlieben oder mich attraktiv finden sollen. Sie sollen meine Arbeit wertschätzen. Das gilt auch für Kritiken. Da lese ich oft solche Dinge wie der lustige Tanzbär oder der Kräftige oder der Pummelige. Bei „Mozart!“ war das im letzten Jahr so, da stand in einer Kritik etwas vom gut beleibten Schikaneder. Das hat es nicht gebraucht. Es ist noch ein langer Weg, aber ich positioniere mich da gern. Ich bin ja auch offen schwul und sage, jeder soll leben wie er lebt. Oder ganz nach „Dirty Dancing“: Das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Die eigene Freiheit endet dort, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Man kann Dinge durchaus nicht schön oder nicht gut finden, aber man muss nicht in so eine aggressive Verteidigungshaltung gehen und denken, dass die eigene Meinung das A und O ist.
Es ist auch sehr fragwürdig, dass man mehrgewichtigen Menschen immer Tipps mit auf den Weg geben oder ihnen ins Gewissen reden will: Denk‘ doch mal an deine Gesundheit, treib‘ doch mal mehr Sport. Alkoholkonsum ist dagegen in Deutschland völlig normal. Da sagt keiner: Trink‘ nicht so viel. Du kannst dich am Freitag auf einer Firmenweihnachtsfeier unter den Tisch saufen und bekommst dafür am Montag in der Firma noch einen anerkennenden Schulterklopfer vom Geschäftsführer und wirst für deine Trinkfestigkeit gefeiert. Aber sobald du ein paar Kilo mehr auf die Waage bringst, sagen die Leute: Denk‘ doch mal an deine Gesundheit. Da wird immer so pseudomäßig Betroffenheit suggeriert, als würde man sich Sorgen um einen machen. Alkohol und Drogen – Kiffen zum Beispiel – sind in unserer Gesellschaft völlig normal. Saufen und Kiffen sind gesellschaftsfähig, Mehrgewicht nicht.
Du hast wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Alkohol und Drogen, und seien es nur Zigaretten, werden normalisiert. Ich trinke auch ab und zu mal etwas, war aber noch nie in meinem Leben besoffen. Ich nehme auch keine Drogen, habe es nie probiert, hat mich nie gereizt. Aber ich kenne Kollegen, die es machen. Da wundere ich mich schon, dass die Leute sonst sehr auf ihren Körper bedacht sind, aber bei Drogen austicken. Keine Ahnung, ob das ein Ausgleich oder Kontrollverlust ist, weil man sich sonst bei der Ernährung kontrolliert und sich beim Essen nichts gönnt. Ich sehe das auch auf der Bühne bei Proben. Es wird warm, die Männer ziehen ihre T-Shirts aus und präsentieren ihre Sixpacks. Ich würde auch gern, weil mir heiß ist, aber irgendwie schäme ich mich doch, weil ich halt ein bisschen bärig aussehe. Ein Kollege hat mich mal gefragt, ob das normal ist und man sein T-Shirt ausziehen muss. Aber ich habe ihm gesagt, dass das nicht normal ist und er das nicht machen muss. Jeder kann es machen, wie er möchte. Man muss gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn man zum Beispiel etwas mehr auf den Rippen hat. Jeder Mensch ist schön. Aber nicht jeder Mensch findet jeden schön. Das ist ja auch okay. Der eine mag Vanilleeis, der andere lieber Schokoladeneis.

Gibt es negative Erlebnisse mit Zuschauerinnen und Zuschauern?
Ja, ich habe es zum Beispiel auf dem Schiff erlebt, dass man als Künstler gesagt bekommt, dass man besser keine Pizza essen sollte. Von fremden Leuten. Das bringt auch die Entwicklung von Social Media mit sich. Heutzutage ist jeder so leicht erreichbar durch Instagram oder Facebook. Teilweise finden die Leute deine Telefonnummer raus durch Lebensläufe, die im Internet kursieren. Mir selbst ist es noch nicht passiert, aber Kollegen, die dann angeschrieben und gefragt werden, ob man mit ihnen mal essen gehen kann. Wenn man nicht reagiert, wird man direkt als unfreundlich hingestellt. Die Grenzüberschreitungen sind schon krass. Bei „The Voice“ gab es eine Frau, die mir permanent Sprachnachrichten bei Instagram geschickt hat. Die hat mich regelrecht gestalkt und wollte sich mit mir treffen. Ich habe ihr gesagt, dass das für mich nicht infrage kommt. Aber sie hat kein Nein akzeptiert, also musste ich sie blockieren. Egal ob Künstler oder nicht: Man kann ja über alles reden, aber man muss auch Grenzen respektieren.
Kommen wir zurück zur Saison in Tecklenburg: Dieses Jahr spielst du Bill in „Mamma Mia!“ und Porthos in „3 Musketiere“. Welche Parallelen gibt es da?
Bill und Porthos sind Lebemänner und, so glaube ich, keine Kostverächter. Porthos natürlich mehr als Bill. Sie sind beide sehr abenteuerlustig und reden frei Schnauze, was ich bei beiden sehr mag. Aber sie sind auch mit gewissen Emotionen ausgestattet, sind sehr mitfühlend, was mir sehr nahe liegt. Porthos hat ein teilweise schon brüderliches Verhältnis zu D’Artagnan, ist zwar älter, aber baut den Jungen auf und sieht sich ein bisschen in der Rolle des Bruders. Bei Bill ist es die Geschichte mit Sophie, die seine Tochter sein könnte. Und ich gehe fest davon aus, dass er ihr Vater ist. Schließlich geht Sophie mit Sky auf Reisen, möchte Abenteuer erleben. Das ist nicht Harry und auch nicht Sam, sondern hundertprozentig Bill.

Du hast erst für „Mamma Mia!“ geprobt, hattest dann an einem Freitag Premiere, hast auch Samstag und Sonntag gespielt, und am Montag gingen die Proben für „3 Musketiere“ los. Dann wurde also für diese Show geprobt, während du parallel „Mamma Mia!“ gespielt hast. Ein enormes Pensum, oder?
Ja, es ist viel. Das Pensum ist enorm in Tecklenburg, dadurch, dass wir gar keinen freien Tag haben. Es ist hart. Und man ist froh, wenn die Premieren gelaufen sind. Das ist nerven- und kräftezehrend. Ganz so nervenaufreibend war es dieses Jahr aber nicht bei mir, weil ich „3 Musketiere“ schon in Magdeburg gespielt habe und dadurch das Stück – die Struktur und die Texte – schon im Kopf hatte. Allerdings hatte ich auch schon mal ein Jahr, wo ich vier Stücke parallel gespielt habe: „Heiße Ecke“ und „Karamba“ in Hamburg sowie „Crazy for You“ und „Nervensache“ in Hildesheim. Das war eine Herausforderung, das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Aber damals war es geil. Die Rollen waren toll, ich hatte Spaß, war danach aber schon ziemlich am Ende.
Porthos und Bill sind ja nicht gerade große Romantiker. Wenn ich jetzt aber an deinen Heiratsantrag denke, den du deinem Partner auf der Bühne bei „SpongeBob“ gemacht hast, scheinst du jedoch ein großer Romantiker zu sein. Ist das so?
Ja, ich bin ein sehr, sehr großer Romantiker. Ich heule auch gern bei romantischen Filmen und bin sehr emotional. Vielleicht bin ich auch in den letzten Jahren ein bisschen emotionaler geworden, durch den Tod meines Vaters. Da werden einem manchmal noch ein paar Dinge vom Leben stärker bewusst. Na ja, und Porthos hat eben mehr eine rustikale Romantik. (lacht) Bill ist von Rosie einfach ein bisschen überfordert, weil nicht er der Macher ist, sondern die Frau. Aber eine romantische Ader muss er haben, denn er ist ja schließlich als junger Mann mit Donna im Boot zur Insel rübergefahren.
Interview: Dominik Lapp

