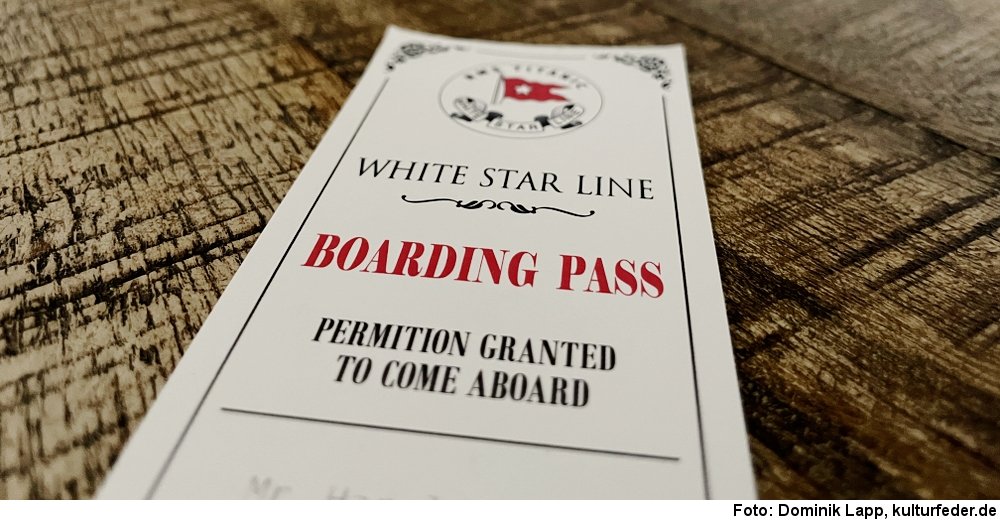
Countdown für den Untergang: Probenbesuch bei „Titanic“ in Tecklenburg
Der Abend senkt sich golden über die Tecklenburger Freilichtbühne. Zwischen den alten Burgmauern, mächtigen Bäumen und der aufsteigenden Abendkühle entsteht ein Wunderwerk aus Licht, Klang und Geschichte. Es ist ein Sommertag, wie er passender kaum sein könnte: Sanftes Sonnenlicht flirrt durch die Blätter, während auf der Naturbühne ein Koloss aus Stahl und Hoffnung langsam Form annimmt. Die „Titanic“ geht als Musical von Maury Yeston (Musik) und Peter Stone (Libretto) ihrem ersten Bühnenlauf entgegen – unter den wachsamen Augen von Regisseur Ulrich Wiggers.
Am Rand des Geschehens, dort wo Natur und Theater nahtlos ineinanderfließen, schrauben Bühnenbildner Jens Janke und seine Assistentin Lisa letzte Nieten in die abstrakte Außenhaut des Schiffs. Es ist ein riesiges stilisiertes Objekt mit mehreren Ebenen, architektonischer Eleganz und feinen Symbolen. „Wir sind gut in der Zeit, das Bühnenbild ist fast fertig“, sagt Janke zufrieden. Und es fügt sich – trotz seiner Wucht – erstaunlich poetisch in die Landschaft.
Ein Probenabend voller Kontraste
Auf der Bühne beginnt der Durchlauf, bei dem Ensemble und Chor einmal das Stück chronologisch proben. Noch ist kein Orchester dabei, Juheon Han – der neue Musikalische Leiter – dirigiert, ein Probenpianist begleitet am Klavier. Doch was an orchestraler Wucht fehlt, gleicht die Intensität der Darstellerinnen und Darsteller aus. Es ist ein Abend, an dem kein Schritt beiläufig wirkt und die rund 70 Menschen auf der Bühne auch ohne Mikrofone schon stimmstark klingen.

„Das Schiff muss leben“, sagt Wiggers im Gespräch. Und das tut es: Während in der dritten Klasse ein irischer Tanz beginnt, gleiten in der ersten Klasse Damen und Herren – heute noch ohne seidene Kleider und Fracks aus der Kostümwerkstatt von Fabienne Ank – über imaginäre Decks. Inmitten der Menge: Hannah Miele in der Rolle der Kate Murphy. Sie gibt eine Auswanderin, die von Irland aus in die Neue Welt will – voller Mut, Hoffnung und mit einem starken Willen. „Kate kommt aus Irland und tut alles dafür, ein neues Leben in Amerika zu beginnen“, sagt Miele. „Sie ist sehr stark und modern, möchte ihren Träumen nachgehen.“ Dann fügt sie hinzu: „Bei mir laufen regelmäßig die Tränen, weil mich ihr Schicksal und das Schicksal der Menschen auf der Titanic so sehr berührt.“
Das Wissen um das Ende
Was das Stück so besonders macht, ist nicht allein das Zusammenspiel von Musik, Bewegung und Ausstattung. Es ist das permanente, unausweichliche Wissen um das Ende. Der Regisseur formuliert es so: „Das Publikum weiß ja von Anfang an, wie diese Geschichte endet. Und doch sieht man auf der Bühne Menschen, die voller Hoffnung auf ein neues Leben in Amerika singen.“ Das sei bitter, aber zugleich wunderschön. Und genau in dieser Spannung, sagt er, liege die große emotionale Kraft des Stücks.
Tatsächlich gelingt es ihm, diese emotionale Fallhöhe mit jedem Bild aufzuladen. Die irische Ausgelassenheit in der dritten Klasse trifft auf die kultivierte Distanz der Oberklasse, das technische Staunen über das Schiff auf die Ignoranz gegenüber drohender Gefahr. „Ich möchte das Leben an Bord zeigen – das pralle, naive, freudige Leben“, sagt Ulrich Wiggers. So lebt die Bühne, und zwar im doppelten Sinne: szenisch und emotional.
Wenn das Wasser kommt
Ein Novum für Tecklenburg ist der Einsatz von Projektionen. Bereits bei „Rebecca“ gab es erste Versuche – nun aber ist das Digitale integraler Bestandteil der Inszenierung. „Wir zeigen den Wassereinbruch auf verschiedenen Decks, machen die Klassenunterschiede sichtbar. Und am Ende will ich sogar die gesunkene Titanic unter Wasser zeigen“, erklärt Wiggers. Es sei ein gewagter Schritt, aber einer, der sich auf dieser Bühne lohne.

Die Technik soll dabei nie in den Vordergrund treten, sondern der Verdichtung der Geschichte dienen. Das Publikum wird Zeuge, wie sich die Bühne verändert, wie das Wasser symbolisch Besitz ergreift. Dazu erklingt Musik, die mitunter mehr Oper als Musical ist – ein dramatischer Klangteppich, den Juheon Han mit großer Präzision vorbereitet. Er arbeitet eng mit Wiggers zusammen. „Juheon ist bei jeder Probe dabei. Das ist ein riesiger Gewinn“, so der Regisseur. Denn nur so entstünden jene kleinen Momente, in denen sich Musik, Spiel und Szene zu einem großen Ganzen verweben.
Das Menschliche im Monumentalen
Trotz aller Technik, trotz riesiger Chorszenen und szenischer Überblendungen – der kreative Kopf der Inszenierung verliert nie das Einzelschicksal aus dem Blick. Im Gegenteil: Die Figuren des Stücks hat es wirklich gegeben. Ihre Geschichten, ihre Namen, ihre Entscheidungen stehen im Zentrum der Inszenierung. Besonders bewegend ist für Ulrich Wiggers die Szene mit dem Ehepaar Straus gegen Ende des zweiten Akts. Ida Straus bleibt bei ihrem Mann auf dem sinkenden Schiff. Der erfahrene Theatermann stockt, als er davon erzählt: „Diese Geschichte berührt mich zutiefst. Ich glaube, ich würde genauso handeln.“
Die historische Dimension des Stoffs ist dem Regisseur spürbar ein Anliegen. Kein Effekt darf Selbstzweck sein, keine Szene Spektakel um des Spektakels willen. „Diese Tragödie muss ernst genommen werden. Es geht um echte Menschen. Da ist keine Spielerei erlaubt.“

So werden Ensemble und Chor zur Stimme der Geschichte – zum atmenden Organ des Schiffs. In einer Szene tanzen die Leute, in der nächsten stehen sie still. Es wird mit einer Liste der Todesopfer gearbeitet. Viele von ihnen – darunter unzählige Kinder – sollen projiziert werden. „Das ist schwer zu ertragen, aber genau deshalb müssen wir es erzählen.“
Der Countdown läuft
In einer Woche ist Premiere. Noch ist nicht alles vollständig, an einigen Übergängen müssen der Regisseur und sein Choreograf Francesc Abós noch arbeiten. Aber das Fundament steht – und es steht fest. „Ich erzähle Geschichten gerne anders“, sagt Ulrich Wiggers. „Aber in diesem Fall war mir wichtig, mich ganz auf die realen Menschen zu konzentrieren.“
Auf der Bühne wird gerade das dramatische Ende geprobt: Wiggers und Abós laufen auf der Spielfläche von einer zur anderen Seite, leiten die Mitwirkenden an, dirigieren und schieben sie zum Teil auf die richtigen Positionen. Die Sonne ist längst untergegangen, es ist deutlich kälter geworden. Der letzte Ton des Klaviers verstummt. Langsam wird klar, was hier auf der großen Naturbühne entsteht: Ein Schiff, gebaut aus Träumen – und Tränen.
Text: Dominik Lapp


